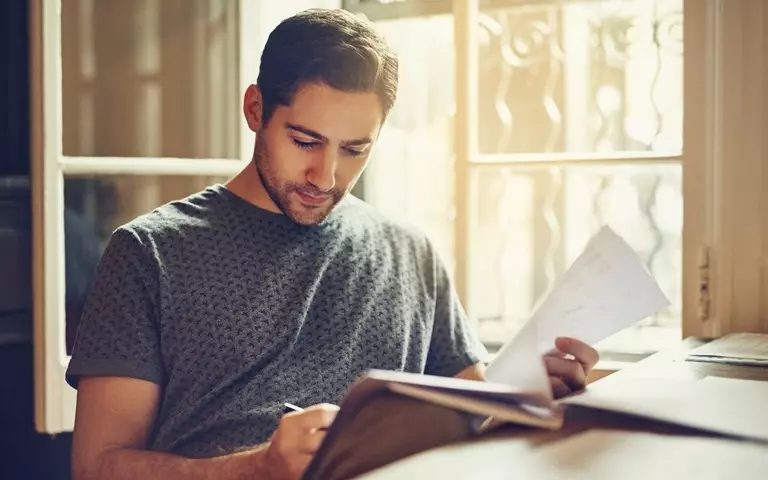Wichtige Informationen für unsere Kunden
Aufgrund der zahlreichen Anfragen, kommt es zeitweise zu Überlastungen unseres Kundenservice. Um Wartezeiten für Sie zu vermeiden, haben wir die wichtigsten Informationen rund um Regelungen und aktuelle Beschlüsse zu den Entwicklungen am Energiemarkt zusammengestellt.
Erfahren Sie in unserer Übersicht die Neuerungen zu den Themen Energiepreisbremse und befristete Mehrwertsteuersenkung für Gas und Wärme. Außerdem beantworten wir für Sie zusammengefasst die wichtigsten Fragen.
Themenübersicht Entwicklungen am Energiemarkt
Antworten auf meistgestellte Fragen
Weitere Kontaktmöglichkeiten
Hausanschrift
Energieversorgung Offenbach AG
Andréstraße 71
63067 Offenbach
24-Stunden Entstörungsnummer
0 800/8060-3030